Weltraumbahnhof, Kosmodrom oder Space Port (Raumhafen) – es gibt viele Begriffe für jene Orte, an denen Raketen ins All starten. Doch was macht einen guten Raumhafen aus, wo liegen die größten und woher stammt eigentlich der Begriff?
Weltraumbahnhof ist ein kurioser Begriff. Nur im Deutschen wird der Ort, von dem aus Raketen ins All starten, als „Bahnhof“ gesprochen. Überall sonst auf der Welt, heißt das „Space Port“ – also Raumhafen“ oder Kosmodrom. Beide Begriffe haben ihren Ursprung in der Schifffahrt, dem „Nautischen“. Überraschend ist das nicht, denn auch das Raumschiff, ist ja ein „Schiff“.
Weltraumbahnhöfe in der Übersicht:
Die Herkunft des „Space Port“
Erstmals tauchte das Wort „Space Port“ in einer Science-Fiction-Kurzgeschichte im Magazin Amazing Stories Quarterly 1931 auf . In „The Birth of a New Republic“ beschreiben Miles J. Breurer und Jack Williamson, wie die Menschheit mit der Hoffnung auf ein besseres Leben Kolonien auf dem Mond baut (Internet Archive, ab Seite 25). Die Parallelen zur Entdeckung und Kolonialisierung Amerikas ist dabei eindeutig.
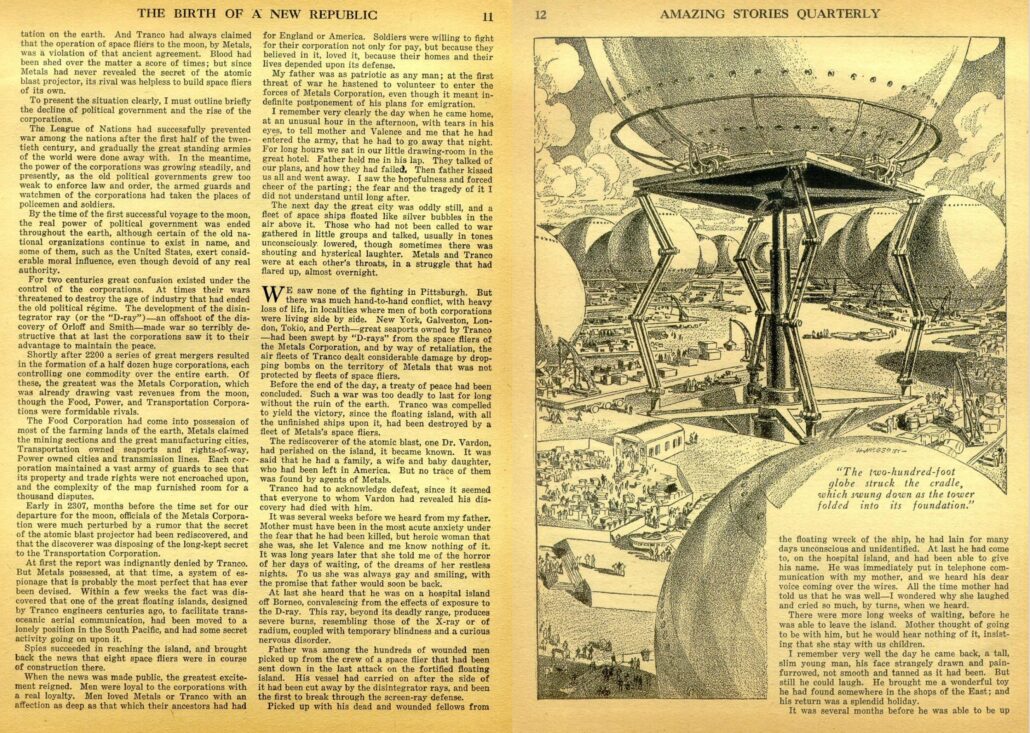
Und hier starten die Menschen von solchen „Space Ports“ aus in die neue Welt. Dass der Begriff mit der Schifffahrt vernetzt ist, dürfte sich vor allem von „Luftschiffen“, also Zeppelinen ableiten. Der in Russland und China verwendete Begriff Kosmodrom setzt sich aus „Kosmos“ (Weltall) und „Drom“ (Laufbahn, Rennbahn) zusammen. Mit dem Begriff „Kosmonaut:in“ für Raumfahrer:innen besteht auch hier der Bezug zur Schifffahrt.
Mit der Dampflock zum Abschussplatz
Dass man im Deutschen „Weltraumbahnhof“ gewählt hat, könnte auf den berühmten ersten Startplatz Baikonur im heutigen Kasachstan zurückzuführen sein. Von dort aus startete Juri Gagarin beispielsweise als erster Mensch ins All. Dort werden noch heute die Raketen mit Eisenbahnwaggons, gezogen von einer Dampflock, zum Startplatz transportiert.

Regeln für einen guten Startplatz
Die klassischen, berühmten Startplätze: Baikonur (Kasachstan), das Kennedy Space Center (USA) und Kourou (Französisch-Guyana) haben einige Gemeinsamkeiten. Damit ein Startplatz geeignet ist, muss er bestimmte Anforderungen erfüllen:
- Äquatornähe: Raketen starten nach Osten und nutzen dabei die Erddrehung wie eine Art Schleuder. Dieser „Sling-Shot-Effekt“ ist stärker, je näher man sich am Äquator befindet. Das spart Treibstoff.
Ausnahme: Wird ein polarer Orbit angesteuert, zum Beispiel für Erdbeobachtungssatelliten, ist auch ein Startplatz im Norden oder Süden sinnvoll. - Klima: Stürme, Gewitter und Erdbeben sind eine Gefahr für Raketen und sorgt dafür, dass Starts wegen schlechter Wetterbedingungen verschoben werden müssen – das steigert die Kosten und bringt den Flugplan durcheinander.
- Sicherheit: Bei Raketenstarts kann immer etwas schief gehen und es können Teile zu Boden fallen. Die enthalten Schadstoff, die für Mensch und Natur gefährlich sind. Deswegen sind die meisten Raumhäfen in dünn besiedeltem Gebiet oder in Ozeannähe.
- Infrastruktur: Vor allem neuere Weltraumbahnhöfe profitieren von kurzen Transportwegen und werden daher so nah wie möglich an Produktionsstätten gebaut
Keiner der aktuellen Weltraumbahnhöfe erfüllt alle Punkte. Am nächsten dran ist der europäische Weltraumbahnhof. Er befindet sich im französischen Überseegebiet Französisch-Guyana in Mittelamerika. Er liegt nah am Äquator, das Klima ist mild und er ist umgeben von Dschungel und dem Atlantik. Allerdings müssen alle Teile per Schiff aus Europa angeliefert werden, was eine Woche dauert und viele Ressourcen verbraucht.

Neben Baikonur ist das Kennedy Space Center in Florida, USA, der berühmteste Raketenstartplatz. Er ergänzt als ziviler Raumhafen seit 1962 den Militärstartplatz Cape Canaveral. Von dort aus Flog Apollo 11 zum Mond und machte den Startplatz 39A unsterblich.
China hat selbst 4 Raumhäfen, der älteste und größte davon ist Juiquan in der Wüste Gobi. Obwohl er weit vom Äquator entfernt nutzt China hier die Höhe von etwa 1.000 Metern über dem Meeresspiegel. Kritik wird an anderen chinesischen Kosmodromen laut, die in besiedelten Gebieten inmitten des Landes liegen. Vor allem beim Kosmodrom Xichang kommt es immer wieder zu herabstürzenden Teilen, die Menschen und Dörfer treffen.
Ähnliche Probleme gibt es auch beim ersten privaten Raumhafen: Starbase in Boca Chica, um US-Bundesstaat Texas. SpaceX startet und produziert hier zum Beispiel sein Starship. Zudem hat das Unternehmen Startplätze im Kennedy Space Center und in Vandenberg, Kalifornien.
Dabei geriet die Firma von Elon Musk, wiederholt mit der US-Flugaufsichtsbehörde FAA aneinander. Sicherheitsvorschriften wurden ignoriert und Raketen mussten wegen Fehlfunktionen geprüft werden und geplante Starts mussten verschoben werden.
Während Elon Musk in der Abteilung Department of Government Efficiency (DOGE) tätig war, wurden Hunderte FAA-Mitarbeiter:innen entlassen. Darunter sollen auch jene Personen gewesen sein, die für die Prüfung von SpaceX zuständig waren. Die dramatischsten Schätzungen ergaben, dass regelmäßige Starts von Florida und Boca Chica aus bei bis zu 12.000 kommerziellen Flügen pro Jahr für Verspätungen sorgen könnten.
Neue Raumhäfen
Der Weltraumsektor wächst nicht nur in den USA, sondern auch in Europa sucht man nach Optionen, um die Startkapazität zu erhöhen. 3 Kandidaten für Weltraumbahnhöfe sehen aus heutiger Sicht am vielversprechendsten aus:
- Der Esrange Space Center in Schweden und der Andøya Spaceport in Norwegen: Ihre Lage bietet gute Bedingungen für polare Starts. Die deutsche Firma Isar Aerospace testete in Norwegen bereits seine Spectrum-Rakete
- SaxaVord, Schottland: Auf den Shetlandinseln in Schottland entsteht der SaxaVord Spaceport. Hier will die deutsche Rocket Factory Augsburg starten.
Podcast
Die gesamte Podcast-Folge zu Weltraumbahnhöfen gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.

